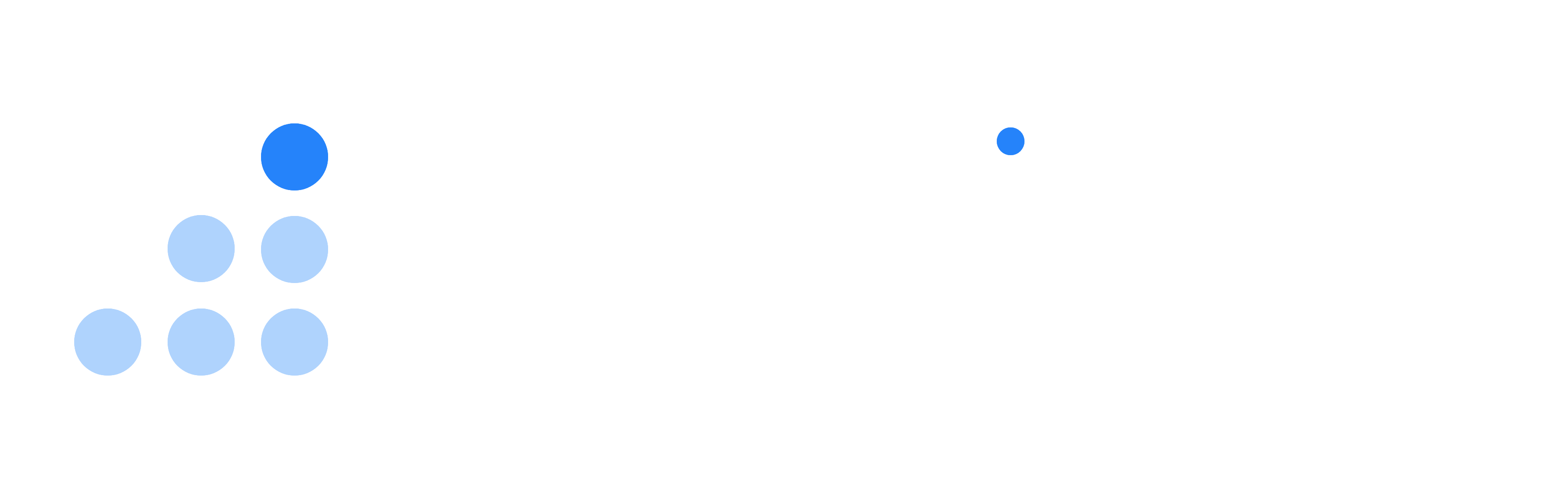Beitragssprünge in der PKV
Jedes Jahr im Herbst erhalten viele PKV-Versicherte Schreiben ihrer Versicherungen zu Beitragserhöhungen ihres Tarifs. Ebenfalls regelmäßig berichten Medien hierüber in ähnlichen Worten (z.B. hier zur Tariferhöhung 2021, 2018, 2017, 2016 oder 2004. Die Medien greifen hier oft Betroffene mit starken Tariferhöhungen auf. Fraglich ist, wie repräsentativ diese sind. Nach Berechnungen des Wissenschaftlichen Instituts der PKV (WIP) lag der durchschnittliche Anstieg der PKV-Beiträge in den letzten 10 Jahren bei 2,6% pro Jahr und damit niedriger als in der GKV. Das WIP berücksichtigt hierbei, dass die GKV-Beiträge für Angestellte mit Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze Jahr für Jahr ansteigen. Zwar bleiben die in Prozenten vom Bruttogehalt angegebenen GKV-Beiträge in den meisten Jahren gleich, allerdings erhöht sich der Beitrag durch den Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze. Man könnte unterstellen, dass das WIP hierbei keine unabhängige Instanz ist. Dennoch ist klar, dass sich die einzelnen starken Erhöhungen, über die berichtet wird, nicht Jahr für Jahr bei allen Versicherten wiederholen. Hier stellt sich die Frage, warum die PKV stattdessen nicht einfach jährliche kleinere Erhöhung vornimmt. Tatsächlich ist ihr dies aus gesetzlichen Gründen nicht möglich. So darf sie zwar – im Unterschied zur Lebensversicherung – die Beiträge im Vertragsverlauf anpassen, wenn sie nicht mehr ausreichen. Allerdings müssen hierzu gewisse Schwellenwerte überschritten werden. So muss etwa die in der Zukunft erforderliche Versicherungsleistung um mehr als 10% von der kalkulierten Versicherungsleistung abweichen. Dies wird trotz der stetig steigenden Gesundheitsausgaben kaum jedes Jahr erreicht werden. Somit hat sich bei jeder Beitragserhöhung ein gewisser Änderungsbedarf angestaut. Ein weiterer Grund für Beitragssprünge steht im Zusammenhang mit den Alterungsrückstellungen. Da die Gesundheitsausgaben im Alter erwartbar steigen, die Beiträge aber konstant bleiben sollen, wohnt jedem PKV-Vertrag ein Sparprozess inne. Vereinfacht gesagt, erhält ein neuer Versicherter mit seinem PKV-Beitrag auch ein Sparbuch, in das er in jungen Jahren einen Teil seiner Beiträge einzahlt, und aus dem später seine Gesundheitsausgaben subventioniert werden. Werden nun die kalkulierten Versicherungsleistungen im Rahmen einer Tarifanpassung erhöht, so steigen die Beiträge der Versicherten überproportional, da sie in der Vergangenheit zu wenig für die später höheren Ausgaben aufs Sparbuch eingezahlt haben und dies nun in kürzerer Zeit nachholen müssen. Zudem zeigt sich eine weitere Eigenart des Sparprozesses: Sinken die Zinsen, so muss für die gleiche spätere Zielsumme mehr gespart werden. In der Vergangenheit kalkulierten die Versicherer mit einem Zinssatz von bis zu 3,5% pro Jahr. Mit einer Beitragserhöhung muss daher oft auch der Zinssatz gesenkt werden, da sich dieser Zinssatz mit risikoarmen Produkten nicht mehr erzielen lässt. Treffen nun ein Erhöhungsbedarf bei den Versicherungsleistungen mit einer Zinssenkung zusammen, kann es zu starken Beitragserhöhungen für einzelne Versicherte kommen. Selbst innerhalb eines Tarifs kann es dabei zu recht unterschiedlichen Anhebungen kommen, da sich etwa je nach Alter und Zugehörigkeitsdauer unterschiedliche Effekte zeigen können.
Um dieses Aufstauen zu vermeiden, hat die Deutsche Aktuarvereinigung einige Vorschläge gemacht, die darauf hinauslaufen, die Beitragserhöhungen zu verstetigen. Allerdings hat der Gesetzesgeber bisher keinen dieser Vorschläge aufgegriffen.